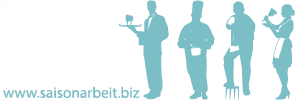Saisonale Beschäftigung ist ein fester Bestandteil des deutschen Arbeitsmarkts. Besonders in den Bereichen Landwirtschaft, Gastgewerbe und Logistik spielen saisonale Arbeitskräfte eine entscheidende Rolle. Sie helfen dabei, temporäre Engpässe in Spitzenzeiten zu überbrücken und sichern in vielen Fällen den reibungslosen Ablauf ganzer Produktions- und Lieferketten. Im Jahr 2025 zeigt sich, dass diese Beschäftigungsform weiterhin eine bedeutende Rolle spielt, auch wenn sich strukturelle Veränderungen und neue Herausforderungen abzeichnen.
Bedeutung der Saisonarbeit
Saisonarbeit bezeichnet zeitlich befristete Beschäftigungsverhältnisse, die aufgrund von wiederkehrenden saisonalen Schwankungen entstehen. Typischerweise betrifft dies Wirtschaftszweige, die witterungsabhängig oder stark nachfragegesteuert sind. Die häufigsten Einsatzbereiche umfassen:
-
Landwirtschaft: Hier werden Saisonarbeitskräfte vor allem für Erntearbeiten – wie Spargelstechen, Erdbeerpflücken oder die Weinlese – eingesetzt. Viele Betriebe wären ohne diese Hilfe nicht überlebensfähig, dies zeigte sich deutlich, als zur Zeiten der Corona-Pandemie Arbeitskräfte aus Osteuropa nicht anreisen konnten.
-
Gastgewerbe: In touristischen Hochzeiten, etwa im Sommer an der Nord- und Ostsee oder im Winter in den Alpenregionen, ist zusätzliches Personal für Hotels, Restaurants und Freizeitangebote gefragt.
-
Logistik und Einzelhandel: Vor allem zur Weihnachtszeit oder bei großen Verkaufsaktionen steigt der Bedarf an Lagerarbeitern, Versandhelfern und Fahrern rasant an.
Saisonarbeit ermöglicht es Betrieben, flexibel auf Nachfrage zu reagieren, ohne dauerhaft teure Personalstrukturen aufbauen zu müssen. Gleichzeitig bietet sie für bestimmte Arbeitnehmergruppen, etwa Studierende oder ausländische Arbeitsmigranten, eine temporäre Beschäftigungsmöglichkeit mit planbarem Zeiteinsatz.
Aktuelle Zahlen zur saisonalen Beschäftigung
Landwirtschaft
In der deutschen Landwirtschaft arbeiten 2025 rund 870.000 Menschen, davon knapp die Hälfte als familienfremde Arbeitskräfte. Ein erheblicher Anteil dieser Beschäftigten – etwa 240.000 – sind Saisonarbeitskräfte. Besonders in intensiven Erntephasen wie dem Frühjahr oder Spätsommer steigt ihr Anteil zeitweise deutlich an.
Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft sind nicht nur in Bezug auf Menge relevant, sondern auch hinsichtlich der Arbeitsstunden. Viele von ihnen arbeiten sechs bis sieben Tage die Woche, oft über zehn Stunden täglich, um die engen Erntezeitfenster effizient zu nutzen. Ohne diese Arbeitskräfte würden viele Felder unbearbeitet bleiben und Ernteausfälle wären unausweichlich – mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen für landwirtschaftliche Betriebe.
Gesamtwirtschaft
Betrachtet man den gesamten deutschen Arbeitsmarkt, so waren im ersten Quartal 2025 rund 45,8 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig. Saisonale Effekte schlagen sich in dieser Zahl meist nur geringfügig nieder, da sie stark branchenabhängig sind. Dennoch beeinflussen sie kurzfristig Beschäftigungsquoten, insbesondere in ländlichen Regionen oder strukturschwachen Gegenden.
Saisonale Beschäftigung trägt dazu bei, kurzfristige wirtschaftliche Impulse zu setzen. Besonders in Zeiten hoher Nachfrage können zusätzliche Arbeitskräfte die Produktivität steigern und Lieferengpässe verhindern. In den Sommermonaten oder im Dezember ist daher regelmäßig ein temporärer Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu beobachten, der danach wieder abflacht.

Herkunft der Saisonarbeitskräfte
Die überwiegende Mehrheit der Saisonarbeitskräfte kommt nach wie vor aus osteuropäischen Ländern wie Polen, Rumänien und Bulgarien. Diese Arbeitskräfte verfügen oft über jahrelange Erfahrung, sind mit den betrieblichen Abläufen vertraut und arbeiten effizient und zuverlässig. Für viele Familien ist die Saisonarbeit in Deutschland eine wichtige Einkommensquelle, die gezielt zur Haushaltsfinanzierung genutzt wird.
In den letzten Jahren nimmt jedoch auch der Anteil von Saisonkräften aus Drittstaaten außerhalb der EU zu – darunter Georgien, Moldau und die Ukraine. Durch bilaterale Abkommen und erleichterte Verfahren wird versucht, neue Arbeitskräftepotenziale zu erschließen. Gerade in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels bietet dies eine willkommene Ergänzung.
Auch die Demografie spielt eine Rolle: Die Zahl der deutschen Saisonarbeitskräfte nimmt weiter ab, was mit dem demografischen Wandel, der Urbanisierung und einer wachsenden Präferenz für planbare, sozial abgesicherte Arbeitsverhältnisse zusammenhängt. Inländische Saisonkräfte werden daher zur Ausnahme, nicht zur Regel.
Arbeitsbedingungen und Herausforderungen
Obwohl saisonale Beschäftigung viele Vorteile bietet, ist sie auch mit spezifischen Problemen verbunden. Saisonarbeitskräfte arbeiten häufig unter hohem Zeitdruck, bei starker körperlicher Belastung und mit begrenzten Pausenmöglichkeiten. Die Bezahlung liegt meist beim gesetzlichen Mindestlohn, der in den letzten Jahren deutlich erhöht wurde. Auch wenn es in Osteuropa eine boomende Wirtschaft mit attraktiven Arbeitsplätzen gibt, ist die Attraktivität einer Saisonarbeit in Deutschland durch diese starken Lohnsteigerungen erhalten geblieben, zumindest bei gering qualifizierten Arbeitskräften. Gerade bei kinderreichen Familien lockt zusätzlich noch die Möglichkeit auf Kindergeld, hier kann bspw. auch für Bulgaren und Rumänen ein Anspruch entstehen.
Ein zentrales Problem ist die fehlende soziale Absicherung. Viele Saisonkräfte sind nur kurzfristig beschäftigt und fallen daher aus der Renten- oder Krankenversicherung heraus. Krankheit, Unfälle oder Arbeitsunfähigkeit bedeuten für sie oft den sofortigen Einkommensverlust. Zudem gibt es regelmäßig Berichte über schlechte Unterbringung, überteuerte Unterkunftskosten oder Verstöße gegen Arbeitszeitregelungen.
Ein weiterer Punkt ist die mangelnde Kontrolle. Zwar gibt es gesetzliche Vorgaben, doch die praktische Umsetzung hängt stark von der Durchsetzung durch lokale Behörden ab. Gerade in entlegenen Regionen oder bei kleineren Betrieben ist die Wahrscheinlichkeit von Kontrollen niedrig, was zu einem Graubereich in der Arbeitswelt führen kann.
Ausblick
Saisonale Beschäftigung wird auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der deutschen Arbeitswelt bleiben – vor allem in Bereichen, in denen Automatisierung keine realistische Alternative bietet. Gleichzeitig steht das System vor einem Wandel: Bessere gesetzliche Rahmenbedingungen, ein fairer Umgang mit den Arbeitskräften und neue Anreize für inländische Arbeitnehmer könnten das Modell nachhaltig stärken.
Die Politik ist gefragt, klare Leitplanken zu setzen – etwa durch eine Verbesserung der sozialen Absicherung, verbindliche Unterbringungsstandards oder eine stärkere Zusammenarbeit mit Herkunftsländern. Auch die Digitalisierung kann einen Beitrag leisten: etwa bei der Vermittlung, Dokumentation und Überwachung von Arbeitsverhältnissen.
Letztlich entscheidet nicht nur die wirtschaftliche Notwendigkeit über die Zukunft der Saisonarbeit, sondern auch, wie fair und menschenwürdig sie organisiert wird. Wenn Deutschland auch künftig auf diese Arbeitskräfte angewiesen ist, muss es auch Verantwortung für deren Arbeits- und Lebensbedingungen übernehmen.